Leicht autistisch und trotzdem kein Mathegenie geworden
»Du guckst wohl Leuten nicht oft in die Augen, wenn du mit ihnen redest?«, sagte sie. Und sie hatte damit einen wunden Punkt getroffen. Ich bin kein Tief-in-die-Augen-Gucker. Ich bin auch kein Hand-auf-den-Arm-Leger. Ehrlich gesagt, ich bin kommunikativ leicht behindert; also abseits der Bühne im zwischenmenschlichen Bereich. Ich rede gern und viel, ich freue mich auch, wenn man mit mir spricht. Aber wenn man sich mit jemandem angeregt unterhält, da merkt man doch schon, ob man sich sympathisch ist oder nicht. Wenn Menschen mich so richtig falsch anlachen, nur um gute Laune zu simulieren, dann sträuben sich mir die Nackenhaare. Man muss sich beim Reden doch nicht auch noch ständig anstarren. Man wird doch dabei auch mal mit einer Bierflasche spielen dürfen.
»Mir ist das In-die-Augen-Gucken oft einfach zu intim«, sagte ich und gucke sie dabei kurz wieder an. »Ich weiß von vielen Menschen, die ich gut kenne, nicht mal, welche Augenfarbe sie haben.«
»Und, welche Augenfarbe hab ich?«, fragte sie.
Jetzt wäre es gut, zu antworten, ohne vorher nachzugucken, das weiß ich, also sagte ich aufs Geratewohl: »Was mit blau, oder?«
Danach durfte ich dann hochgucken, sie schien mit der Auskunft zufrieden. Ich streifte also schnell über ihre Pupillen. Na, bei dem Licht hier ist da ohnehin kaum was zu erkennen.
In der Schule, beim alten »Wer-guckt-wem-länger-in-die-Augen« -Spiel war ich eigentlich nie so schlecht gewesen. Ich habe diese pubertären Blickduelle sogar oft gewonnen. Es gibt nämlich diesen Trick. Also man schaut dabei dem Anderen gar nicht wirklich in die Augen, man guckt durch ihn hindurch, auf einen gedachten Punkt viel weiter hinten im Raum. Das kann man stundenlang machen. Ohne diesen Trick wäre ich damals jedem Gegner und jeder Gegnerin hoffnungslos unterlegen gewesen. Und seit ich diesen Trick beherrsche, ein Trick, den man auch braucht, um auf diesen knallbunten pseudo-dreidimensionalen Bildern dieser Magisches-Auge-Scherzbücher, die vor einigen Jahren Mode waren, etwas erkennen zu können, seither misstraue ich allen anderen In-die-Augen-Guckern. Die bescheißen doch bestimmt auch. Wie oft habe ich schon erlebt, dass mich jemand vermeintlich anstarrt, bis ich gemerkt habe, nee, der guckt gar nicht mich an, der guckt nur eben ständig knapp an dieser Frau vorbei, deren Hinterkopf zwischen uns beiden angeregt hin und her wackelt.
Obwohl, wahrscheinlich haben viele das gar nicht nötig. Die gucken einfach ganz dreist mitten rein: tief in die Augen. Ich meine, nicht dass da so aussergewöhnlich was zu sehen wäre. Von wegen Spiegel der Seele, oder so? Augen sind zum Rausgucken da, reingucken kann da nur ein Augenarzt mit seiner Spezialleuchtlupe. Und was sieht er? Ein Stückchen Netzhaut. Das wars dann aber auch.
Die Herren und Damen von der psychologischen Fakultät wollen herausgefunden haben, dass jemand, der offensichtlich lügt, dabei immer unwillkürlich zwinkern muss. Zweimal, direkt hintereinander. So schnell, dass man das oft gar nicht mitkriegt. George Bush hatte zu Anfang seiner Präsidentschaft ein ziemliches Problem, dauernd hat er gezwinkert, aber mittlerweile glaubt er alles was er sagt.
Und ich? Ich lüge doch nicht. Meist selbst dann nicht, wenn es die Höflichkeit eigentlich gebieten würde. Ich sag jedem, der danach fragt, wie alt ich bin, wie wenig ich verdiene, und zur Not sage ich sogar, was ich wiege. Obwohl ich all diese Fragen eher indiskret finde. Ich selbst würde nie eine Frau nach ihrem Alter, Einkommen und Gewicht fragen. Was sollte ich denn mit diesen dussligen Informationen auch schon anfangen? Einen Steckbrief anlegen?
»Weißt du, das ist nicht einfach, mit jemandem zu reden, der einen dabei so selten anguckt«, sagte sie.
»Ich weiß«, sagte ich. »Also nicht für mich, für mich ist das normal. Ich kontrolliere quasi nie, ob mich jemand beim Sprechen auch immer ordentlich anguckt. Es genügt mir, wenn er mit mir spricht. Aber die meisten Menschen machen das wohl so.«
Es gefiel ihr nicht, dass ich sie als einen der meisten Menschen bezeichnet hatte, aber sie schluckte es tapfer runter. Ich konnte das Schlucken förmlich hören. Dann sagte sie: »Das wirkt, wie soll ich sagen, irgendwie linkisch, so als ob du was zu verbergen hättest.«
»Ich weiß!«, sagte ich noch mal. »Ich kann dich ab jetzt auch öfter mal angucken, wenn du das möchtest.«
»Hä?«
»Na ja, ich kann mich ja mal anstrengen.?«
Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich wußte es. Auch ohne sie anzusehen, wußte ich, dass sie jetzt schon leicht unwirsch wird.
Müssen andere Leute anderen Leuten immer in die Augen gucken, um so was zu sehen? Man kriegt das doch auch so mit. Ich höre es. Die Stimme, der Tonfall. Ich bin vielleicht nicht so gut im »In-die-Augen-Gucken«, aber im Hören bin ich ausgezeichnet. Ich erkenne Stimmen immer wieder. Viel besser als Gesichter. Wenn ich mit Birgit vor dem Fernseher das Synchronsprecher-Erraten-Spiel spiele, gewinne ich quasi immer. Ich muss nur die Augen schließen, und schon höre ich, dass der Professor in »Tanz der Vampire« von dem Mann gesprochen wird, der ganz oft Edward G. Robinson seine Stimme gegeben hatte. Wenn ein bekannter Schauspieler mal nicht seine Standard-Synchronstimme hat, dann nervt mich das ungemein.
Ich bin so auch ein ausgesprochener Fan von Harald Juhnke geworden. Solange ich ihn nicht sehen muss. Als Synchronsprecher war er fast immer großartig. Manchmal denke ich, wenn ich nur eine wirklich gute Stimme hätte, dann wäre das Vorlesen wirklich meine Berufung. Aber mit meinem quäkigen Organ? Na ja. Bei mir im Kopf klingt meine eigene Stimme viel wärmer und weicher.
»Ich heiße Elke, wie heißt du eigentlich?«, fragte sie.
Oh Gott! Ein weiterer wunder Punkt. Ich finde meinen Namen ziemlich daneben. Diese Unterhaltung wird nicht mehr lange dauern, ich schließe jede Wette ab. Wer heißt denn schon gerne Jürgen? Also wenn er nicht gerade Berliner Polizist im mittleren Dienst ist.
»Jürgen«, sagte ich, und setzte hinzu »aber ich bin nicht besonders stolz drauf.«
»Was heißt denn das jetzt wieder?«, fragte sie.
»Ist vielleicht nicht so wichtig«, sagte ich, »aber manchmal denke ich, weil ich meinen eigenen Namen nicht sonderlich abkann, kann ich mir auch die Namen anderer Leute so schlecht merken! Ich bin nämlich ganz schlecht im Namen merken.«
Können wir nicht über irgend ein Thema reden? dachte ich. Sag mir, wie du die Welt siehst, und ich sag‘s dir auch. Ob deine Eltern dich Elke oder Eva genannt haben, das ist doch ziemlich egal, oder? Aber nee, über Namen reden, so fängt das immer an. Nun frag mich schon wie du heißt. Noch weiß ich‘s.
»Weißt du was?«, sagte sie plötzlich resigniert, » Du bist ziemlich kompliziert!«
Das Todesurteil. Schon beim ersten Small-talk kompliziert sein, das sollte man nun wirklich tunlichst vermeiden.
»Was kann ich denn dafür?«, möchte ich ihr zurufen: »In die Augen gucken und meinen Namen sagen, das sind die zwei wirklich doofen Sachen. Sonst bin ich, glaub ich, halbwegs normal!« Aber es ist eh zu spät. »Ich hab das alles doch nicht erzählt, um mich damit irgendwie interessant zu machen.« Sie hat sich abgedreht, hat die Beine andersrum übergeschlagen und scannt schon heimlich das Lokal. Jetzt, wenn ich sie ganz intensiv ansehen würde, dann, wenn ihr Blick in einer Minute oder zwei zufällig wieder in meine Richtung hin schweift, dann wäre ihr das sicher auch sehr peinlich.
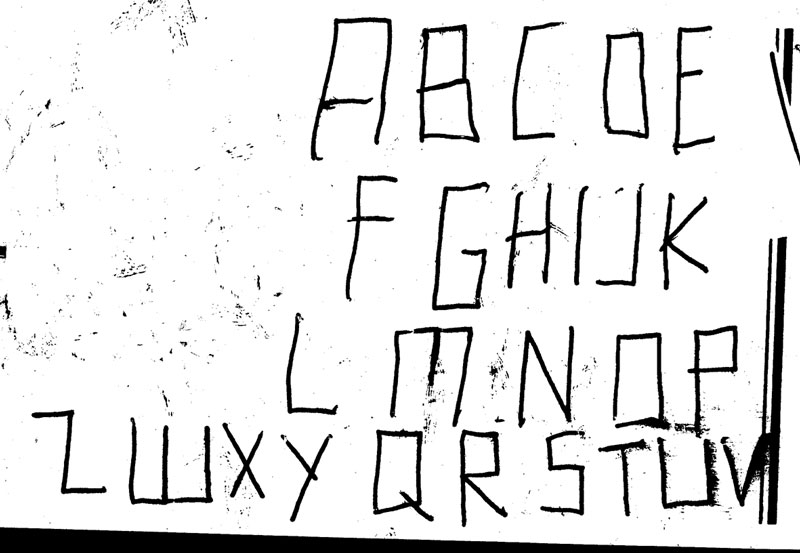
Jürgen Witte
Jürgen Witte (*1956 in Karlsruhe). 1979 Flucht nach Berlin (West). Vortragender Autor beim ›Frühschoppen‹ und in der ›Reformbühne‹. Salbader-Senioren-Redakteur, lebt in Steglitz und hat nur das alte Web 1.0.
